|
CD-ROM Bausteine gelingender
Hilfeplanung Modellprogramm „Fortentwicklung des Hilfeplanverfahrens” |
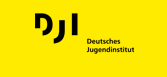
| > | |||
| > | |||
| > | |||
| > | Buch und CD: Erziehung braucht eine Kultur der Partizipation |
||
_ Werkstattbuch INTEGRA
In den nächsten fünf Beiträgen werden die eigenen Organisationsveränderungen
(3.5) und die Schnittstellen im Sozialraum innerhalb der Jugendhilfe – auch innerhalb der
Hilfen zur Erziehung – in den Blick genommen. Dabei benutzt das Werkstattbuch unter-
schiedliche Begriffe wie Kooperation, Verzahnung, Einbindung oder Integration, die eine
divergente Qualität des jeweiligen Zusammenspiels beschreiben. In den Blick geraten
die Dienste und Angebote der offenen Jugendarbeit (3.7), der Regeleinrichtungen (3.6),
die Heimerziehung (3.8) und – exemplarisch am Beispiel der geschlechtsspezifischen
Angebote (3.9) – spezialisierte Angebote und Dienste. In weiteren Beiträgen werden
Fragen der Qualitätsentwicklung (3.10), der sozialraumorientierten Jugendhilfeplanung
(3.12) und flexibler Finanzierungsstrukturen (3.13) aufgegriffen.
Im vierten Kapitel werden auf 146 Seiten insbesondere Materialien zur Strukturentwicklung
integrierter, flexibler und sozialraumorientierter Erziehungshilfen zusammengetragen,
die in den Modellregionen entwickelt und genutzt wurden. Es handelt sich hierbei um
Verfahren, vertragliche Regelungen und Absprachen zwischen öffentlichen und freien
Trägern. Dazu gehören beispielsweise das Leitbild und die Leitsätze zur Weiterentwicklung
integrierter Erziehungshilfen, Indikatoren flexibler Erziehungshilfen, Geschäftsordnungen
der Stadtteilteams, Regelungen zum Ablauf der Hilfeplanung, Hilfeplanformulare, Materialien
zur Adressatenbefragung und zur kollegialen Beratung, Arbeitsblätter zur
ressourcenorientierten Fallarbeit, Kooperationsvereinbarungen zwischen dem öffentlichen
und freien Träger, Dokumentationsraster für fallübergreifende Leistungen im Gemeinwesen,
Vereinbarungen für die Kooperation mit Regeleinrichtungen, Qualitätsentwicklungs-
vereinbarungen / Leitbilder, Verträge und Leistungsvereinbarungen aus den verschiedenen
Modellregionen.
Das Projekt INTEGRA setzte neben der Strukturentwicklung auf Qualifizierung (3.11)
und Professionalisierung der Fachkräfte. Hier knüpft auch die Idee des Werkstattbuchs an.
Das Buch liefert den fachlichen Hintergrund und bietet Materialien an, die anregen und
auf die Sprünge helfen sollen. Didaktisch unterstützt wird der Werkstattcharakter durch
die originelle Aufmachung: Im DIN A 4-Format als Ringbuch gebunden kann das Buch
auch äußerlich flexibel genutzt werden. Inhaltlich wird dieser Anspruch dadurch eingelöst,
dass jeder Artikel mit einer Zusammenfassung endet und mit ein paar weiterführenden
Literaturangaben zur Vertiefung der Materie eingeladen wird. Einschränkend sei allerdings
erwähnt, dass ausführlichere Hinführungen zu den einzelnen Beiträgen eine schnellere
Orientierung ermöglichen würden.
Die Beiträge sind inhaltlich aufeinander bezogen, stehen aber losgelöst voneinander,
so dass sich der sporadische Leser ohne Probleme quer durchs Buch lesen kann.
Der inhaltliche Aufbau der Beiträge folgt nicht der gewählten formalen Symmetrie und
Stringenz und ist Ausdruck des Werkstattcharakters. So folgen die Themen und Beiträge
auch ganz unterschiedlichen Strickmustern: Mal erhält man einen fachlichen Überblick über
den Stand der Diskussion, mal wird ein Aspekt theoretisch fundiert, dann wieder werden
exemplarisch einzelne von vielen denkbaren, in der Praxis vorhandenen Instrumenten
und Konzepten vorgestellt. Häufig erhält man auch Einblicke in die Modellregionen durch
Beschreibungen der jeweiligen Arbeitsfelder, durch die vergleichende Darstellung der
Arbeitsweisen, Verfahren und Instrumente.
Die ausgewählten Themen spiegeln inhaltlich und vom Aufbau der Beiträge her die
spezifischen Projekterfahrungen in den jeweiligen Umbau- und Reformprozessen wider.
Mal bleiben Konzepte Konzepte, mal wurden sie empirisch überprüft und praktisch
umgesetzt. Neugierig wird man an einzelnen Stellen, wenn die Erfahrungen in den
Reformprozessen mit all den Schwierigkeiten und den Erfolgen zum Tragen kommen,
wenn Konzept und Erfahrung zu reflektiertem Wissen verschmelzen. In einigen Artikeln
im gesamten Buch werden genau solche Hinweise gegeben, wie beispielsweise:
„Reformen gelingen (...), nachhaltiger, wo über Personen und Verfahren zugleich
gesteuert wird und wo frühzeitig alle Ebenen, insbesondere auch die politischen
Entscheidungsebenen, kontinuierlich beteiligt sind” (S. 31) – ein Wissen, das sowohl
für weitere Praxisforschungen in Reformprozessen als auch für Reformer vor Ort hilfreich ist.
Den Autoren gelingt es, das Modell einer lebensweltorientierten, sozialräumlichen,
ressourcenorientierten, flexiblen, integrierten Jugendhilfe verstehbar und greifbar zu
machen. Das Projekt hat insbesondere Wissen, Erfahrung und Materialien im Bereich
der kooperativen Qualitätsentwicklung, der vernetzten Organisationsentwicklung und
der sozialraumorientierten Jugendhilfeplanung produziert: Es ist in dieser Hinsicht
wegweisend und Mut machend.
Nützliche Instrumente und Materialien für die konkrete Hilfeplanung hingegen sind nur
begrenzt vorhanden. Ausgeblendet bleiben beispielsweise Modelle und Formen der
Fallabklärung, der fallbezogenen Kooperation und des Casemanagements, die sich
nicht alleine auf ein ressourcen-, sozialraum- und lebensweltorientiertes fachliches
Konzept stützen, sondern die an den Schnittstellen zu Hilfen jenseits der Grenzen der
Jugendhilfe das Zusammenspiel mit anderen Hilfesystemen, Disziplinen und Professionen
suchen.