|
CD-ROM Bausteine gelingender
Hilfeplanung Modellprogramm „Fortentwicklung des Hilfeplanverfahrens” |
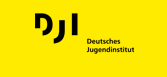
| > | |||
| > | |||
| > | |||
| > | Buch und CD: Erziehung braucht eine Kultur der Partizipation |
||
Nachlese
„Erfahrungen vererben sich nicht – jeder muss sie allein machen”, meinte einst der
deutsche Schriftsteller und Satiriker Kurt Tucholsky. Erfahrungen, die andere bereits
gemacht haben, können allerdings zu wertvollen Wegweisern für das eigene Handeln
werden. In unserer Nachlese finden Sie Hinweise auf solche Erfahrungs-Schätze:
Es handelt sich um zusätzliche Materialien und Arbeitshilfen, die einen Beitrag
für eine erfolgreiche Kinder- und Jugendhilfe leisten können.
_ Deutschendorf, René/Hamberger, Matthias/Koch, Josef/Lenz, Stefan/Peters,
Friedhelm (Hrsg.), 2006: Werkstattbuch INTEGRA. Grundlagen, Anregungen
und Arbeitsmaterialien für integrierte, flexible und sozialräumlich ausgerichtete
Erziehungshilfen. Weinheim und München Juventa Verlag, 372 Seiten, Loseblatt-
Sammlung, ISBN 3 7799 1876 5
(Buchbesprechung von Dr. Christa Neuberger, in: Forum Erziehungshilfe 2006,
12. Jg. Heft 3, S. 190-191):
Implementierung und Qualifizierung integrierter, regionalisierter Angebotsstrukturen
in der Jugendhilfe am Beispiel von fünf Regionen” – so lautete der vollständige Arbeits-
Titel des INTEGRA-Projekts, das von 1998 bis 2003 durchgeführt wurde und dessen
Ergebnisse jetzt in einem Werkstattbuch versammelt sind. INTEGRA strebte eine tief
greifende Umgestaltung der (Infra-)Struktur erzieherischer Hilfen in fünf Modellregionen
an. Die gesamten erzieherischen Hilfen – und nicht nur einzelne Leistungsangebote –
sollten zu einem kooperativ gesteuerten Hilfesystem umgebaut werden, das als Ganzes
durch die Merkmale Flexibilität, Integration und Sozialraumorientierung gekennzeichnet ist.
Nun, zwei Jahre nach Abschluss, zieht das Projekt nochmals Bilanz und lädt mit dem
„Werkstattbuch INTEGRA” ein, die Erkenntnisse des Projekts gewinnbringend in der Praxis
anzuwenden.
Das Buch hat dabei aus meiner Sicht zwei Botschaften: Es möchte zum einen das fachlich
anspruchsvolle Programm von INTEGRA, nach thematischen Blöcken sortiert, theoretisch
untermauert und konzeptionell ausdifferenziert der Fachöffentlichkeit nahe bringen. Und
es möchte zum anderen auf Basis der eigenen Projekterfahrungen künftigen Reform-
prozessen und ihren Akteuren Handwerkszeug und Orientierungshilfe für die Steuerung
und Planung einer tragfähigen Infrastruktur erzieherischer Hilfen geben.
Im ersten Kapitel werden die „Ausgangsphilosophie” (S. 10), das Projekt, die Zielsetzungen,
die theoretische Begründung und das Reformprogramm sowie die Ergebnisse und
Erkenntnisse zusammenfassend dargelegt. Das zweite Kapitel vereint Beiträge mit ganz
unterschiedlichen Aspekten: So werden beispielsweise zentrale Bausteine thematisiert,
die für Praxisentwicklungsprozesse an der Schwelle zwischen Forschung und Praxis
Relevanz haben, wie etwa die Bedeutung eines Changemanagements und zentrale
Merkmale und Voraussetzungen gelingender Praxis in Umbau- und Reformprozessen
(2.1). Auch auf die Notwendigkeit der systematischen Selbstbeobachtung durch Evaluation
und Verfahren des (Fach-)Controllings (2.3) wird hingewiesen. In einem weiteren Beitrag
gehen die Autoren der Frage nach, welcher Qualitätsgewinn bei einer verbindlich
geregelten, ziel- und sozialraumorientierten Kooperation zu verzeichnen ist, die zwischen
dem öffentlichen und den freien Trägern und zwischen den freien Trägern sowie einer
Steuerung, die in eine Netzwerkkoordination übergeht, vereinbart wird (2.2). Weiterhin
erhält man Einblick in die Ergebnisse einer Befragung der Adressaten und Adressatinnen
zu ihrer Sicht auf die Hilfe (2.4). Zudem gibt das Buch Antworten auf die juristischen
Gesichtspunkte sozialraumorientierter Erziehungshilfen (2.5).
Im dritten Kapitel werden Einzelaspekte der veränderten Praxis vertieft: In vier Beiträgen
wird unter anderem Handwerkszeug zur Qualifizierung der fallbezogenen Hilfe vorgestellt.
Zunächst führen die Autoren in das Hilfeplanverfahren nach § 36 SGB VIII mit seinen
fachlichen Prämissen ein und beschreiben unterschiedliche Modelle der in den
Modellregionen implementierten kooperativen Falleingangsverfahren (3.1.). Kollegiale
Beratung stellen sie beispielhaft an einem Modell-Ablauf vor (3.2). Ausführlich gehen sie
auch auf das Konzept der Ressourcenarbeit ein und stellen praktische Instrumente für
die Fallarbeit zur Verfügung (3.3). Im Übergang vom „Fall zum Feld” werden sozialraum-
und ressourcenorientierte Handlungsansätze und in der Praxis erprobte Formen der
Dokumentation und Überprüfung fallübergreifender und fallunspezifischer Leistungen
dargestellt (3.4).